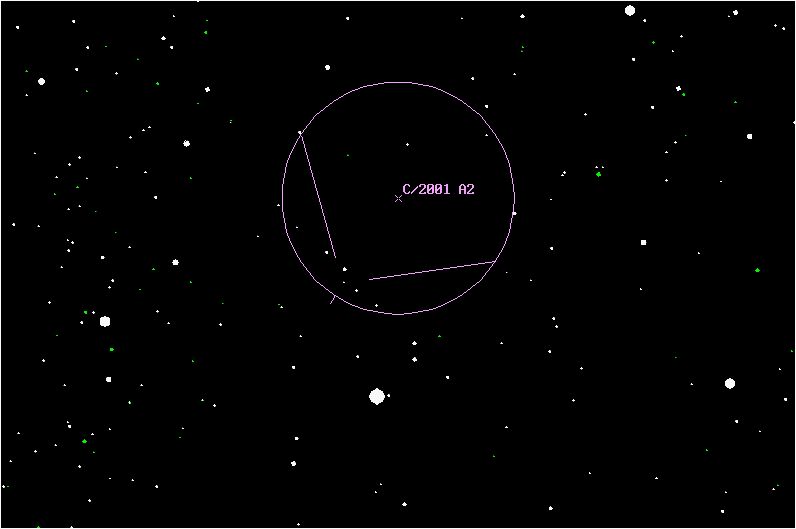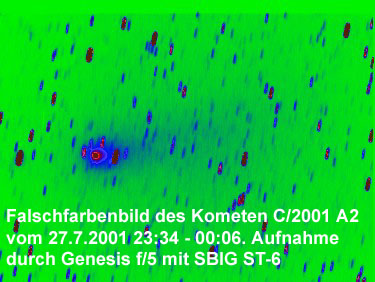Kometen beobachten mit der CCD-Kamera
Die Beobachtung von Kometen ist ein geradezu ideales
Einsatzgebiet für die CCD-Kamera. Die Vorteile liegen auf der Hand:
- Keine Chemikalienschlacht in der Dunkelkammer
- Ergebnis sofort sichtbar
- Die Aufnahmen sind in der Regel astrometrierbar
- Auch lichtschwache Kometen sind im Bereich des Möglichen
- Schnell bewegliche Kometen können durch Aufnahmeserien verfolgt
werden
- CCD geht auch aus der Stadt heraus
Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile:
- PC/Laptop am Teleskop nötig
- Erhöhter Strombedarf, gerade auf freiem Feld ein Problem
- Viel zu schleppen
- Große und helle Kometen sind in analoger Technik
ästhetischer
Nicht jeder hat eine ortfeste Sternwarte. Zum Betreiben des Equipments
muß ich in der Regel zwei Autobatterien mitnehmen. Eine für die
CCD-Kamera und eine für den Rest (Teleskop/Computer). Wenn ich alles
wirklich nötige Equipment in Betrieb habe, dann komme ich auf einen
Stromverbrauch von 10 Ampere! Alleine die CCD-Kamera genehmigt sich davon schon
4 Ampere...

Nachdem das Fernrohr aufgestellt und eingenordet ist, wird zunächst einmal
der Prozess des Scharfstellens durchlaufen. Idealerweise kann man dafür
die Zeit nutzen, die die CCD-Kamera zum Abkühlen benötigt. Ist auch
dieser Punkt abgehakt, kann es dann ja endlich losgehen. Zum Auffinden der
Kometen sollte man sich eine vernünftige Sternkarte mitnehmen. Ich selbst
habe auf meinem Laptop Guide installiert. Das macht die Sache deutlich
einfacher. Es ist nämlich gar nicht so leicht, einen lichtschwachen
Kometen auf dem CCD-Chip zu positionieren. Selbst die Grenzgröße von
Guide ist da manchmal nicht ausreichend. Sehr hilfreich ist das vorherige
Ausdrucken einer Aufsuchkarte, eventuell unter Zuhilfenahme des
USNO-Sternenkataloges, den Guide mit einbinden kann. Das Identifizieren des
Sternenfeldes ist trotz dieser Hilfsmittel manchmal nicht sehr einfach, da die
CCD-Kamera im roten Licht ihr Empfindlichkeitsmaximum besitzt. Dadurch sind die
scheinbaren Helligkeiten in der Aufnahme doch deutlich verschoben und das
Identifizieren wird manchmal etwas erschwert.
 |
Ein CCD-Bild mit der dazugehörigen Sternkarte |
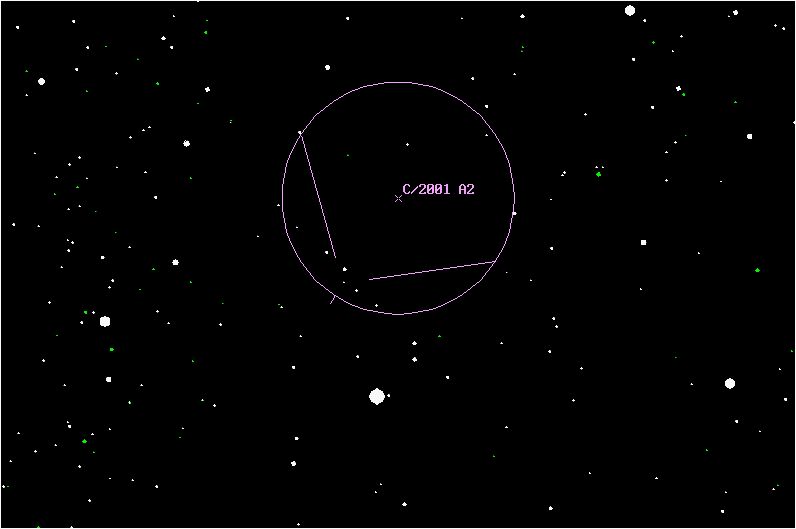 |
Auch ist es enorm wichtig, dass man die aktuellsten Bahnelemente der
Kometen verwendet. Für Guide findet man diese z.B. fertig unter
dieser Adresse.
Manchmal erkennt man den Kometen auf der Aufnahme
nicht sofort. Das ist besonders dann der Fall, wenn der Komet eine fast
stellare Erscheinung ist. Hier hilft dann nur eine Serienaufnahme des
entsprechenden Gebietes mit anschließendem Einsatz der
Blinkkomperatorfunktion der CCD-Software. So lässt sich durch Blinken ein
eventuelles bewegliches Objekt aufspüren. Wenn der Komet sich nur ganz
langsam bewegt, dann lässt er sich auch durch das Addieren der einzelnen
Aufnahmen finden, da dann das Signal-/Rauschverhältnis deutlich verbessert
ist.
Hat man dann den Kometen im Bild gefunden, kann man an die
eigentliche Bildverarbeitung gehen. Sehr wichtig ist das sorgfältige
Erstellen von Darkframes und Flatfields. Diese Korrekturen sind sowohl für
die „pretty pictures" als auch für die Astrometrie ein absolutes
Muß. Kometenbilder besitzen die gleiche Charakteristik wie z.B.
Galaxienaufnahmen, d.h. wir haben viel Information in den recht dunklen
Bildpartien. Das schreit geradezu nach logarithmischer Skalierung, die auch in
diesem Fall zu schönen Ergebnissen führen wird. Um den Schweif
deutlicher sichtbar zu machen, ist es manchmal sinnvoll, das Bild zu
invertieren. Für das Auge sind dann schwache Informationen deutlicher zu
erkennen. Auch die Verwendung einer Farbpalette anstelle von Graustufen ist in
dieser Hinsicht ein gutes Hilfsmittel.
 |
Durch die Verwendung von Falschfarben werden Strukturen
sichtbar |
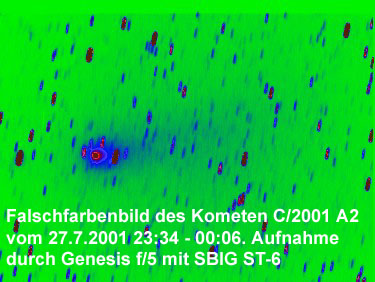 |
Zurück zur Hauptseite